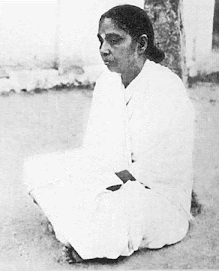Fortsetzung des BriefeschreibensWas mich am meisten ermutigte war, dass Bhagavan begonnen hatte mich herbeizurufen und mir alles zu erzählen, was sich während meiner Abwesenheit in der Halle ereignet hatte. Er sagte: »Du warst nicht da. Das ist während deiner Abwesenheit geschehen. Sie haben mir diese Fragen gestellt und ich habe ihnen jene Antwort gegeben.« Und er erzählte mir alles viel ausführlicher als jemals zuvor. Kunju Swami, Muruganar und andere enge Freunde meinten: »Ist es nicht ein Jammer, dass du diese Dinge nicht mehr aufschreibst, wenn Bhagavan dir alles so ausführlich erzählt? Er tut das nur, weil er erwartet, dass du alles aufschreibst. Er macht das mit keinem von uns. Deshalb ist es eindeutig falsch, wenn du nicht mehr schreibst.«
Ich war sehr betroffen und fing wieder mit dem Schreiben an. Am 3. September 1947 begann ich mit dem dritten Teil meiner ›Briefe aus dem Ramanashram‹. Da ich alle anderen Aufgaben abgegeben hatte, konnte ich mich jetzt voll aufs Schreiben konzentrieren.
Veluri Sivarama Sastri kam mit seinem ersten Cousin zu Bhagavans Darshan. Nach dem Mittagessen besuchten sie mich. Ich berichtete ihm, wie es dazu gekommen war, dass ich mit dem Schreiben aufhören musste und zeigte ihm die Briefe, die den dritten Teil ausmachen würden. Er las einige davon und meinte: »Was auch immer für Hindernisse und Versuchungen kommen mögen, bitte gib diese Arbeit nicht auf. Es ist eine Mission, die von Bhagavan inspiriert ist. Warum zweifelst du daran?« Ich erwiderte: »Warum bittest du eine ungebildete Frau wie mich darum zu schreiben? Ihr alle seid große Gelehrte. Warum bleibt ihr nicht hier und schreibt?« Sivarama Sastri lächelte und sagte: »Wir könnten diese Arbeit nicht tun. Weil unser Geist von den Sastras und anderen literarischen Werken eingenommen ist, können wir die innere Bedeutung der Lehren von großen Weisen wie Bhagavan nicht aufnehmen. Das Lernen ist ein großes Hindernis auf dem spirituellen Pfad. Du hast keine solchen Schwierigkeiten, da du Bhagavan als personifizierten Gott betrachtest und alles, was er sagt, für dich wie die heiligen Schriften ist. Deshalb musst du diese Arbeit tun. Es ist eine Verpflichtung. Lass dich nicht mehr entmutigen. Verstehe es als deine Aufgabe.«
Das war nicht nur ein Ratschlag, das war ein regelrechter Befehl. Ich fühlte mich sehr ermutigt und schrieb fortan ohne Unterbrechung.
Chinnaswami fragte mich immer wieder, ob ich noch diese Briefe schreiben würde, was ich jedes Mal verneinte. Je mehr du auf einen Gummiball schlägst, desto höher hüpft er. So war es auch hier. Je mehr Chinnaswami versuchte, mich am Schreiben zu hindern, desto emsiger floss die Tinte aus meinem Füller.
Doch ich fühlte mich schuldig, weil ich ihn anlog. Ich sagte zu Bhagavan: »Ich habe alles aufgeschrieben, was du gestern gesagt hast. Ich würde gerne wissen, wo der Vers zu finden ist, auf den du dich bezogen hast.« Er nannte mir dann das entsprechende Buch und sprach ausführlich darüber. Auf diese Weise verschaffte ich mir indirekt Gewissheit, dass er von meinem erneuten Schreiben wusste und es seine Zustimmung fand. Dennoch waren meine Zweifel immer noch nicht völlig ausgeräumt. Deshalb bat ich ihn, die neuen Briefe durchzusehen. Da meinte er: »Sie sind bei dir sicherer. Behalte sie bei dir.«
Chinnaswami arbeitete eine Zeit lang in der Küche, da es an Köchen fehlte, und ich half ihm gelegentlich. Als ich eines Tages in die Küche kam, sah mich Chinnaswami an und bemerkte: »Die Leute sagen, dass die Frauen schreiben und die Männer in der Küche arbeiten.« Ich fragte: »Swami, soll ich die schwere Küchenarbeit übernehmen?« »Das ist es nicht«, erwiderte er. »Du isst wenig. Wie kannst du da stark genug sein, die reguläre Küchenarbeit des Ashrams zu übernehmen? Alles, was ich damit sagen will, ist: gib das Schreiben auf und meditiere stattdessen.« Ich tat so, als würde ich ihm zustimmen, doch ich gab das Schreiben nie mehr auf, zumal es immer das eine und andere Gespräch in der Halle gab und ich der Versuchung nicht widerstehen konnte, es festzuhalten.
Eines Tages war ich des Schreibens müde und wünschte mir, jemand würde mir dabei helfen. Ich ging zu Bhagavan und setzte mich in seine Nähe. Er erzählte gerade die Geschichte von dem Spatzen und Garuda und machte dabei die Bemerkung: »Leute, die Gutes tun und Selbstergründung üben, geben ihre Arbeit niemals auf, selbst wenn sie sie als eine Last empfinden. Wie im Fall des Spatzen in der Geschichte, dem Garuda zu Hilfe kam, kommt von irgendwoher Hilfe. Durch die Gnade Gottes kommt die Hilfe von selbst.« Diese unerwartete Botschaft ermutigte mich sehr.
Immer wieder fragten die Leute aus dem Ashrambüro, ob ich noch schreiben würde und ich verneinte. Ich fühlte mich schuldig, da es nicht stimmte. Ich fragte mich, warum ich ständig lügen und diese Briefe in einer so negativen Atmosphäre schreiben sollte. Warum sollte ich es nicht einfach aufgeben? Mit diesem Zweifel ging ich zu Bhagavan. Er erzählte gerade Vorfälle aus seinen Kindertagen und sagte: »Ich habe meine Tante belügen müssen, als ich Madurai verließ. Es sind nicht wir, die die Lügen aussprechen. Irgendeine Kraft lässt es uns tun. Selbst Shankara konnte nur durch eine Lüge sein Leben als Sannyasin aufnehmen.«
Auf diese Weise klärte Bhagavan immer wieder meine Zweifel bezüglich der Briefe.
Um herauszufinden, ob ich immer noch schreiben würde, kamen bestimmte Leute zu den ungewöhnlichsten Zeiten zu mir. Aber jedes Mal, wenn sie auftauchten, hatte ich nur die alten Briefe bei mir. Wenn sie mich fragten, ob ich immer noch schreiben würde, sagte ich ihnen, dass ich lediglich die alten Briefe korrigieren würde. Einige glaubten mir, aber manche äußerten Chinnaswami gegenüber ihre Bedenken. Was konnte er tun? Wenn er mich danach fragte, sagte ich, dass ich nichts schreiben würde. Wenn er mir arg zusetzte, kamen mir die Tränen. Das erweichte ihn und er sagte: »Geh meditieren.«
Platzreservierungen
Einige Frauen reservierten sich ihre Plätze in der Halle und ließen jenen, die später kamen, keinen Platz mehr übrig. Deshalb quetschte ich mich immer irgendwo hinten hin. Wenn Bhagavan etwas Schriftliches in Telugu erhielt oder jemand in Telugu eine Frage stellte, sah Bhagavan sich nach mir um und fragte: »Wo ist Nagamma?« Jemand sagte mir, dass Bhagavan nach mir verlangte und ich ging nach vorne. Die anderen Frauen hatten dann keine andere Wahl, als mir Platz zu machen. Satyananda, einer von Bhagavans Helfern, meinte, ich sollte mich doch immer in die vorderste Reihe setzen. Bhagavan bemerkte lächelnd: »Aber seht ihr denn nicht, dass alle Plätze bereits reserviert sind.« Alle lachten. Wenn jemand fortan seinen Platz reservierte, bevor er hinausging, sagte Bhagavan humorvoll: »Da seht bloß, sein Platz ist reserviert.«
Einmal saß ich beim Fenster ganz hinten in der Halle und sah geistesabwesend auf den Arunachala. Sooramma sagte zu mir: »Bhagavan sieht immer in unsere Richtung.« Ich stand auf und ging zu ihm. Er gab mir ein Gedicht, das er gerade erhalten hatte. Ich las es durch und schrieb es ab. Sooramma meinte: »Wir sollten aufmerksam sein, was Bhagavan tut oder sagt und nicht andersherum. Ist es nicht ein Affront gegen den Guru, wenn du so weit von ihm weg sitzt?« Ich nahm mir ihren mütterlichen Ratschlag zu Herzen und war von nun an aufmerksamer.
Einige Tage später sprach Bhagavan von den Affen. »Seht euch die Affen an. Wenn einer von ihnen nur mit den Augen blinzelt, kommen sofort alle herbei und versammeln sich um ihn. Deshalb wird in der Sprache des Vedanta die Aufmerksamkeit mit dem Blick eines Affen verglichen. Wenn der Guru den Schüler anblickt, muss der Schüler diesen Blick sofort verstehen. Wie kann er sonst aus seiner Schülerschaft irgendeinen Nutzen ziehen?« Das war für mich eine gute Lektion. Von da an war ich aufmerksamer denn je.
Wenn jemand Geschichten aus den Puranas erwähnte, nahm Bhagavan das entsprechende Buch aus dem Regal und las die Geschichte laut vor. Wenn es Tragödien waren, war er offensichtlich tief berührt. Er weinte und konnte nicht mehr weiterlesen. Er legte dann das Buch auf sein Sofa und sagte: »Ich weiß, dass das alles nur Geschichten sind, dennoch wird der Körper davon berührt. Er hält nicht still.«
Einmal las Bhagavan die Geschichte über Tara aus dem Ramayana vor. Da traten ihm Tränen in die Augen und seine Stimme begann zu beben. Es war, als würde das ganze Drama vor ihm aufgeführt. Ich sagte: »Bhagavan scheint sich in Tara verwandelt zu haben.« Da nahm er sich zusammen und sagte mit einem Lächeln: »Was soll ich machen? Ich identifizierte mich mit jedem. Ich habe keine getrennte Identität. Ich bin universal.«
Als ich mit dem Schreiben der ›Briefe aus dem Sri Raman-ashram‹ begonnen hatte, gab ich es auf, schon am frühern Morgen zum Parayana in den Ashram zu gehen. Ich badete, kochte, erledigte andere Arbeiten und ging gegen 7.30 Uhr zum Ashram. Bhagavan war um diese Zeit auf dem Berg spazieren und wir warteten auf seine Rückkehr. Ich setzte mich auf die nördliche Seite im Speisesaal. Ich konnte dann sehen, wie Bhagavan den Berg herunterkam. Er sah aus wie der Herr Shiva, der vom Himmel auf die Erde herabsteigt.
Nur in den Morgenstunden gab es in der Halle Gespräche über verschiedene Themen. Deshalb war ich immer da. Manchmal gab jemand Bhagavan ein Gedicht oder er selbst schrieb einen Vers, wenn ich bereits nach Hause gegangen war. Bhagavan gab dann den Vers einem seiner Gehilfen und sagte: »Bewahre ihn sorgfältig auf. Wir müssen ihn morgen Nagamma zeigen. Wir wissen nicht, ob sie zum Parayana da sein wird.«
Manchmal spürte ich, dass ich ausnahmsweise zum morgendlichen Parayana erscheinen sollte. Wenn Bhagavan mich dann kommen sah, sagte er: »Ich habe gerade gesagt, dass man dir diese Schriftstücke geben soll und da kommst du auch schon. Woher weißt du das?« Ich erwiderte: »Ich habe irgendwie gespürt, dass ich diesmal kommen sollte.« Bhagavan sagte, dass es solche Zufälle auch mit verschiedenen anderen Menschen geben würde.
Ausflug zum SkandashramIm Winter 1947 war mein Bruder mit seiner Frau im Ashram. Er wollte mit seinen Freunden zum Skandashram. Meine Schwägerin wollte gerne mitkommen, doch er befürchtete, sie würde es nicht schaffen und ging ohne sie. Am selben Abend fuhr er nach Madras zurück. Meine Schwägerin wollte noch etwas länger im Ashram bleiben und deshalb ließ er sie bei mir. Ich versicherte ihr, dass ich alles tun würde, um sie zum Skandashram zu bringen.
Am nächsten Morgen gingen wir beide in die Halle und setzten uns in die vorderste Reihe. Ich sagte zu Bhagavan: »Meine Schwägerin wollte gestern mit meinem Bruder zum Skandashram, aber er hat sie nicht mitgenommen, da sie gesundheitlich angeschlagen ist. Sie möchte sehr gerne dorthin.«
Meine Schwägerin sah Bhagavan flehend an. Da wurde sein Herz weich und er sagte zu mir: »Warum macht ihr euch Sorgen? Du kannst sie hinbringen. Er muss in Eile gewesen sein. Ihr könnte morgen hingehen.« »Ja, ich werde sie selbst hinbringen. Aber ich fürchte, sie wird nicht in der Lage sein, den Berg hinaufzusteigen«, erwiderte ich. Bhagavan meinte: »Wie komisch! Ich habe viele Leute auf den Gipfel des Berges gebracht, die viel älter als sie waren. Manche waren über 80 Jahre alt. Was ist das Problem? Brecht am frühen Morgen auf, solange es noch nicht heiß ist. Nehmt einen Ochsenkarren bis zu den vorderen Stufen des Berges und dann geht die Stufen hinauf, eine nach der anderen. Bleibt oben, bis es abkühlt, und kehrt auf demselben Weg zurück. Nehmt etwas zu Essen mit.«
Meine Schwägerin freute sich sehr und strahlte über das ganze Gesicht. Sie hatte die nötige Kraft gewonnen und ich den nötigen Mut.
Noch am selben Abend bestellte ich einen Ochsenkarren und kaufte Obst, Puffreis, Kichererbsen und andere Nahrungsmittel. Am nächsten Morgen nach dem Frühstück verabschiedeten wir uns von Bhagavan und brachen zum Skandashram auf. Chinnaswami gab uns noch ein Päckchen Iddlies mit auf den Weg. Zwei Patasala-Schüler begleiteten uns. Zu jener Zeit lebte Venkataraman, der jetzige Ashram-Präsident, in der Stadt. Als er von unserer Pilgertour zum Skanashram hörte, schlossen sich uns Lakshmi und zwei weitere ältere Damen aus seinem Haushalt an. Wir gingen langsam die Stufen hinauf, besuchten die Virupaksha-Höhle und andere Höhlen, die auf dem Weg lagen, und kamen gegen 10 Uhr im Skandashram an. Es stießen noch mehr Leute zu uns. Wir waren schließlich eine Gruppe von 15. Jemand brachte gewürzten Reis mit, jemand anderer Uppuma und noch jemand anderer Buttermilch. Wir schickten die beiden Schüler zum Ashram zurück, damit sie Bhagavan Bescheid geben konnten, dass wir sicher eingetroffen waren. Wie glücklich wir doch alle dort waren! Es war unbeschreiblich! Wir redeten, sangen, hörten Musik und was nicht noch alles. Bhagavan bemerkte: »Es scheint dort oben sehr schön zu sein. Sie haben sich alle zu einer großen Gruppe zusammengefunden. Wir haben keine Möglichkeit, einen solchen Ausflug zu machen. Was kann man tun? Sie werden nicht vor 4 Uhr zurück sein.«
Wir blieben bis gegen 3 Uhr auf dem Berg. Als wir im Ashram ankamen, sagte Bhagavan: »Ihr seid zurück? Lakshmi, auch du warst dabei? Das ist gut.« Dann fragte er, ob meine Schwägerin Schwierigkeiten gehabt habe. Ich verneinte.
Wir waren uns alle einig, dass dieses große Fest nur durch Bhagavans Gnade möglich gewesen war. Mein Bruder war sehr erstaunt, als er davon hörte.
Als meine Schwägerin 1949 den Arunachala zu Fuß umrunden wollte, erhob mein Bruder keinen Einwand mehr, sondern erzählte Bhagavan davon. Sie nahmen einen Wagen mit, für den Fall, dass meine Schwägerin nicht den ganzen Weg gehen konnte. Doch durch Bhagavans Gnade benötigte sie den Wagen nicht. Am Abend meinte Viswanatha Brahmachari vergnügt: »Wenn deine Schwägerin nicht nur zum Skandashram hinaufgekommen ist, sondern sogar den Berg umrundet hat, hat sich das Sprichwort bewahrheitet: ›Durch die Gnade des Gurus reden die Stummen und die Lahmen überqueren Berge.‹«
Ich habe viele solche außergewöhnlichen Ereignisse beobachtet. Ich glaube nicht, dass es Wunder sind, sondern lediglich Manifestationen der Verbindung von Meister und Schüler.
Hirse
Seit 1940 esse ich Hirse statt Reis und brachte auch Bhagavan davon. Er ließ sich Salz und Chilli bringen, streute es darüber, verteilte es unter allen Anwesenden und nahm eine kleine Portion für sich selbst. Da er es offensichtlich mochte, bereitete ich es häufig für ihn zu. Als Bhagavan das bemerkte, meinte er: »Warum machst du dir diese Arbeit? Ab und zu ist es in Ordnung, aber nicht ständig.« Da machte ich es für längere Zeit nicht mehr.
Einmal bereitete ich frisch geerntete Hirse zu. Da kam Bhagavans Gehilfe Venkataratnam herein. Als er die weiße Hirse sah, meinte er: »Wie schön! Bhagavan mag sie sehr.« Ich sagte ihm, dass ich sie Bhagavan bringen wollte, aber befürchtete, dass er mich wieder ausschelten würde. Venkataratnam meinte, es sei nun schon einige Zeit her, dass ich ihm davon gebracht hätte und er würde sicher gerne davon essen. Ich bat ihn etwas zu kosten, aber er lehnte ab, da Bhagavan zuerst davon essen sollte. Ich probierte auch nichts, sondern schüttete die Hirse in ein tragbares Gefäß und brachte es am Nachmittag zu ihm. Bhagavan meinte lächelnd: »Oh, du hast wieder einmal Hirse gebracht?« Ich nahm meinen Mut zusammen und erwiderte: »Seit dem letzten Mal ist über ein Jahr vergangen. Diese Hirse ist frisch geerntet. Die Körner sind weiß wie Jasminblüten. Es hat nicht einmal zwei Annas gekostet und ich sollte wenigstens ab und zu die Gelegenheit haben, Bhagavan etwas zu bringen.« Bhagavan wurde weich. »Es ist in Ordnung«, sagte er. »Ich mag es sehr gerne. Ich will nur nicht, dass du dir damit zu viel Arbeit machst. Als ich auf dem Berg lebte, habe ich alle Arten von Körnern gegessen. Hirse schmeckt gut und ist gesund.« Er gab Erdnüsse, Salz, Chilli und Ghee hinzu, verteilte sie an alle und aß genussvoll seine kleine Portion.
Als ich ihm später wieder einmal Hirse brachte, meinte er: »Du scheinst die ganze Zeit im Ashram zu verbringen. Wann hast du Zeit zum Kochen?« Ich erzählte ihm, dass ich solche Dinge immer nach dem Mittagessen zubereitete. Da wandte er sich an Venkataratnam und fragte: »Sie kommt schon morgens um 7 Uhr. Wann kocht sie für sich?« Venkataratnam erwiderte, dass ich schon um 3 Uhr aufstehen und um 7 mit allem fertig sein würde. »Aber wann schreibt sie?«, fragte Bhagavan. Ich erwiderte: »Am Abend. Ich esse etwas Leichtes und schlafe dann für eine Weile. Um Mitternacht wache ich immer von selbst auf. Ich schreibe etwa eine Stunde lang und lege mich dann wieder schlafen. Um 3 Uhr wache ich von selbst auf. Ist das nicht genügend Schlaf?«
Srimati Suramma, die in meiner Nähe wohnte, meinte: »In ihrem Haus brennt die ganze Nacht das Licht. Gott allein weiß, wann sie schlaft.« Bhagavan nickte nur und schwieg.
Im Frühjahr 1947 kam von der Ashramverwaltung die Anweisung, dass keiner mit Bhagavan unnötig sprechen sollte, da es ihm gesundheitlich nicht gut ginge. Wir hielten uns alle strikt daran. Eines Tages kam ich um 2 Uhr nachmittags in den Ashram. Bhagavan las im Periyapuranam. Als er mich bemerkte, sagte er enthusiastisch: »Sieh her, das sind die Geschichten von Sundaramurti, Sambandar, Manikavachakar und Appar
[1]« und begann, mir ihre Geschichten zu erzählen. Er erzählte mir eine Geschichte nach der anderen, bis am späten Nachmittag die Post gebracht wurde. Danach erzählte er mir eine weitere Geschichte, bis seine Helfer seinen Spazierstock und sein Wassergefäß für den Abendspaziergang für ihn bereithielten. Bhagavan sagte: »Oh, die Zeit ist um« und ging hinaus.
Das ›Na Karmana‹
Wenn eine Puja oder eine andere religiöse Feier im Ashram stattfand, war es üblich, dass die Leute eine Schale mit Früchten, Blumen, Kampfer und Räucherstäbchen zu Bhagavan brachten, das ›Na Karmana‹ rezitierten und ihn um seinen Segen baten. Erst wenn Bhagavan die Gegenstände berührt hatte, konnte die Feier beginnen.
[Na Karmana:
Unsterblichkeit erlangt man nicht durch Taten,
nicht einmal durch Nachkommen
oder den Besitz von vielem Gold.
Doch einige erlangen sie durch Verzicht.
Die Weisen, die ihre Sinne völlig unter Kontrolle haben,
erlangen dieses Sat,
das weitaus größer als der Himmel ist
und unaufhörlich im Herzen erstrahlt.
Die Meister, die durch Entsagung und Konzentration
reinen Herzens sind
und die Gewissheit dieser einen Wahrheit,
die das Vedanta bekundet,
erkannt haben,
erlangen Selbstverwirklichung.
Ist die Unwissenheit verflogen,
erlangen sie die volle Befreiung vom Körper
und von Maya, seiner Ursache.
Nur das, was frei aller Sorgen als feinster Äther
im Herzen des Lotus ewig erstrahlt,
der winzige Sitz des reinen Höchsten
im Innersten des Körpers,
das allein sollte man verehren.
Er allein ist wahrhaft der Höchste Herr.
Er ist weit über das Ur-Wort
[2] erhaben,
das Anfang und Ende des Veda ist
und in das der Ursprung der Schöpfung eingeht.
[3]Ein Devotee meinte: »Immer, wenn irgendeine Puja stattfinden soll, bringen die Leute alle dafür nötigen Dinge zu Bhagavan, damit er sie durch seine Berührung segnet. Puja ist aber eine Handlung (Karma). Gleichzeitig rezitieren sie das Mantra ›Na Karmana‹, das besagt, dass die Befreiung nicht durch Karma (Handeln) und auch nicht durch Nachkommen und Wohlstand erlangt werden kann, sondern nur durch Entsagung. Widerspricht sich das nicht?«
Bhagavan lächelte und sagte: »Ja. Wenn die Leute die wahre Bedeutung dessen verstehen würden, was sie rezitieren, würden sie das alles nicht tun. Wie oft wird dieses Mantra hier vorgetragen? Es wäre gut, wenn die Leute die Bedeutung verstehen und in die Praxis umsetzen würden. Aber wer macht das schon? Es werden Rituale vollzogen, um Gott zu verehren. Trotzdem ist es eine gute Sache. Ich verliere nichts dabei, wenn ich die Puja-Artikel berühre, und deshalb mache ich es. Das ist alles.«
Ein anderer Devotee bat Bhagavan, ihm die Bedeutung des Mantras zu erklären.
Der Meister antwortete: »Vor einiger Zeit stellte ein Devotee dieselbe Frage und ich zeigte ihm den Kommentar, den Vidyaranya dazu geschrieben hat. Er meinte, er könne ihn nicht richtig verstehen, und deshalb musste ich ihn ihm erklären. Um solche Fragen künftig zu vermeiden, übertrug ich das ›Na Karmana‹ ins Tamil. Das war etwa 1938. Später haben die Leute es eingerahmt und im Speisesaal aufgehängt.«
Ein anderer Devotee brachte das eingerahmte ›Na Karmana‹, damit die Leute es lesen konnten. Da fragte ich, ob es auch ins Telugu übersetzt worden sei. Bhagavan erwiderte: »Ich weiß es nicht.« »Hat Bhagavan es übersetzt?«, fragte ich. »Nein, aber wozu sollte ich? Du kannst es ins Telugu übersetzen, wenn du willst.«
Ich wollte ihn nicht weiter damit bedrängen und übersetzte es selbst ins Telugu.
Was Bhagavan istAls ich 1944 alle telugischen Gedichte in ein Notizbuch abschrieb, stieß ich auf ein Gedicht von Durbha Subramanya Sastri und zeigte es Bhagavan. Er deutete auf einen Vers: »Es heißt dort: ›Was für ein Dummkopf du doch bist! Du hast dein wertvolles Wissen, das du dir durch Tapas in den verschiedenen Höhlen auf dem Berg erworben hast, nicht unter ein Copyright gestellt, sondern es allen frei zugänglich gemacht.‹ Er nennt mich einen Dummkopf. Das ist doch irgendwie gut.« Wir waren über Bhagavans Worte amüsiert.
Unter anderen Papieren kamen telugische Gedichte von Vinnakota Venkataratnam zum Vorschein. Als ich Bhagavan fragte, wann Venkataratnam diese Gedichte geschrieben hatte, antwortete er: »Lange bevor du in den Ashram gekommen bist war er für einige Zeit hier. Bevor er wieder ging, hat er diese Gedichte geschrieben. Er nennt mich darin einen, der die Leute überrumpelt. Es gibt verschiedene Beschreibungen von mir. Wer könnte sie in Frage stellen?«
Einige Tage später erschien ein Artikel von Souris in einer telugischen Zeitschrift. Srinivasa Mouni, der sich um die eingehende Post kümmerte, brachte das Heft zusammen mit der anderen Post. Nachdem Bhagavan alle Briefe gelesen hatte, gab er sie zurück. Mouni ließ die Zeitschrift da und bemerkte lächelnd: »Was für ein Dieb Bhagavan doch ist!«
Als Bhagavan den Artikel in der Zeitschrift gelesen hatte, gab er ihn mir und sagte: »Es ist ein Artikel, den Souris über mich geschrieben hat. Lies ihn laut vor, damit alle Anwesenden es hören können.« Ich las ihn vor. Gegen Ende hieß es: »Schließlich hat Bhagavan mich völlig verschlungen, d.h. mein Ego. Was für ein Dieb!« Da lachten alle, die Telugu verstanden.
Bhagavan sagte: »Ich weiß nicht, was ich wirklich bin. Sarma sagt, ich sei ein Dummkopf, Vinnakota sagt, ich würde die Leute überrumpeln und Souris sagt, dass ich ein Dieb bin. Jeder muss für sich entscheiden, was genau ich bin. Nayana nennt mich einen Koch. Ja, das eine oder andere. Alles sind gute Bezeichnungen.« Wir lachten und er stimmte in unser Gelächter ein.
Welches Glück hat doch dieser Sabari!
S. Doraiswami Iyer war ein erfolgreicher Anwalt in Madras und verdiente gut, gab dann aber seine Praxis auf, um sein Vermögen dem Aravindashram zu spenden. Fortan lebte er dort als ein Ashram-Bewohner. Gelegentlich kam er zum Ramanashram. Ich schrieb gerade Gedichte in ein Notizbuch, als er in die Halle kam und sich hinsetzte. Er beobachtete, wie Bhagavan mich gelegentlich herbeirief und mir Anweisungen für die Abschrift gab.
Als ich die Halle verließ, schlich er sich unbeobachtet hinter mich und sang das berühmte Lied von Thyagarajan: »Welches Glück Sabari doch hat, welches Glück hat doch dieser Sabari!« Ich wunderte mich über das unerwartete Singen hinter mir und drehte mich um. Er sah mich lächelnd an. Ich fragte ihn, warum er dieses Lied singe. Da deutete er auf mich und sagte: »Ja, Amma (Mutter), ich sage, dass dieser Sabari großes Glück hat. Bhagavan spricht nicht mit uns, wie viele Fragen wir ihm auch stellen mögen. Aber dich ruft er herbei und fragt: ›Wo ist Nagamma?‹. Er spricht immer wieder mit dir. Welches Glück du doch hast!« Ich freute mich natürlich sehr darüber.
Keine EinschränkungenFür rechtgläubige Frauen ist es Brauch, dass sie während ihrer Monatsblutung weder lesen noch schreiben.
[4] Ich habe mich lange daran gehalten und ging während der drei oder vier Tage nicht zum Ashram. Meine Arbeit, die tamilischen Schriften, die wir von verschiedenen Leuten erhielten, abzuschreiben, häufte sich während dieser Zeit an. Bhagavan beobachtete das eine Zeit lang.
Als ich deswegen das vierte Mal abwesend war, kamen einige Gedichte per Post und sollten abgeschrieben werden. Als man sie Bhagavan überreichte, sagte er zu Rajagopala Iyer: »Wir haben diese Gedichte erhalten, aber Nagamma ist nicht erschienen. Sie ist jeden Monat einige Tage nicht da. Selbst ein Herrscher muss um Urlaub ersuchen, aber nicht die Frauen. Sie bleiben einfach weg wie es ihnen gefällt und wir können daraus unsere Schlüsse ziehen. Geh zu ihr und bring ihr diese Gedichte und das Notizbuch. Sie kann sie abschreiben, wenn sie Muse dazu hat. Sie soll sich zuerst die Korrekturfahnen ansehen, da wir sie sofort zur Druckerei zurückschicken müssen.«
Rajagopala Iyer brachte mir die Schriftstücke und erzählte mir alles, was Bhagavan gesagt hatte. An diesem Tag verschwanden alle meine Bedenken über die Einschränkungen während meiner Monatsblutung. Ich kümmerte mich sofort um die Korrekturfahnen und machte die Abschriften.
Bhagavans Geburtstag ist ein wichtiges Ereignis. Die meisten Devotees kommen am Morgen seines Geburtstags und bleiben bis abends, aber einige Ältere kommen bereits einen Tag früher und bleiben einen Tag länger. Deshalb ist es im Ashram drei Tage lang sehr betriebsam.
Einmal hatte ich während seines Geburtstags meine Tage. Ich saß verstimmt auf meiner Veranda und brütete über meine missliche Lage. Da ich nicht zur gewohnten Stunde im Ashram aufgetaucht war, kam Subbaramayya zu mir, um zu sehen, was los war. Als ich es ihm erklärt hatte, sagte er ein paar tröstende Worte und ging zurück. Bhagavan fragte ihn: »Warum ist Nagamma nicht gekommen?« Subbaramayya erklärte es ihm und erzählte ihm auch, dass ich sehr niedergeschlagen sei. Bhagavan meinte: »Warum? Sie kann meditieren.«
Seit diesem Tag bin ich überzeugt, dass es nicht nötig ist, während der Monatsblutung vom Meditieren zu lassen. Man muss von den Unreinheiten des Geistes frei werden. Das ist es, was wirklich zählt. Dasselbe gilt auch für die Schreibarbeiten.
Fasten
An besonderen Tagen fastete ich. Oft kamen gerade dann viele Gedichte, die ich abschreiben sollte. Bhagavan sah sie sich sorgfältig an, anstatt sie nur oberflächlich durchzusehen, wie er es tat, wenn ich da war. Rajagopala Iyer fragte ihn, warum er sich die Mühe machte, anstatt sie Nagamma zu geben. Bhagavan gab darauf keine Antwort. Deshalb ging ich zu ihm und bat um die Schriftstücke, doch er gab sie mir nur widerwillig.
Da erinnerte ich mich an Echammals Nichte Chelammal, die das Fasten aufgab, weil sie erkannte, dass der Dienst für Bhagavan wichtiger war. In einem Gedicht heißt es: »Wenn man in der Gesellschaft von heiligen Menschen ist, braucht man keine religiösen Einschränkungen auf sich zu nehmen. Wenn der kühle Wind bläst, wozu braucht man dann einen Fächer?«
Kunju Swami hatte auch an bestimmten Tagen gefastet. Bhagavan hat ihn dann mit keiner Arbeit betraut. »Wie können wir ihm Arbeit geben, wenn er vom Fasten geschwächt ist?« Als Kunju Swami davon erfuhr, gab er das Fasten auf.
Einmal fragte ein Devotee Bhagavan über die Bedeutung des Fastens. Er sah ihn gütig an und antwortete: »Wenn alle Tätigkeiten aufgegeben werden, wird der Geist auf eins gerichtet. Wenn solch ein Geist sich auf Gott konzentriert, ist das das wirkliche Fasten (Upavasam). ›Upa‹ bedeutet ›nahe sein‹ und ›Vasam‹ bedeutet ›leben‹. Er lebt in seinem Selbst. Wünsche sind die Nahrung des Geistes. Sie aufzugeben ist Upavasam. Wenn keine Wünsche mehr da sind, gibt es auch kein solches Ding wie den Geist. Was übrig bleibt ist das Selbst. Wenn man geistig fasten kann, muss man nicht körperlich fasten. Jenen, die nicht geistig fasten können, wird empfohlen körperlich zu fasten, um den Geist zu reinigen.«
Alles kommt zum VorscheinEinige Devotees im Ashram hatten etwas Unrechtes getan. Da fragte ein Devotee Bhagavan: »Bhagavan, warum benehmen sich die Leute selbst in deiner Gegenwart auf diese Weise?« Bhagavan antwortete lächelnd: »Wie könnte es anders sein? Das, was innen ist, kommt ans Tageslicht. Was nicht in einem Menschen ist, kann auch nicht herauskommen. Das Gute kommt zum Vorschein, aber ebenso das Schlechte. Nichts kann für lange Zeit verborgen bleiben.« Der Devotee fragte: »Das bedeutet, dass die Gegenwart eines Jnanis oder Mahatmas wie ein Spiegel ist. Was innen ist, spiegelt sich nach außen. Ist es so?« »Ja. Die Gedanken desjenigen, der mir gegenübersitzt, spiegeln sich hier. Wo Leute zusammenkommen, geschehen solche Dinge. Man kann nichts machen.«
Annamalai Swami kümmerte sich um die Errichtung der Ashramgebäude. Eines Tages kam er in die Halle, während alle still meditierten. Bhagavan fragte ihn, ob eine bestimmte Mauer fertig sei und ob der Bau des neuen Zimmers begonnen habe. Da fragte ein Devotee: »Bhagavan, warum sprichst du mit Annamalai Swami immer nur über die Bauarbeiten?« Bhagavan erwiderte: »Jedes Mal, wenn er kommt, scheint es als ob die Gebäude selbst kommen würden. Was kann ich tun? Mit welchen Gedanken die Leute auch immer zu mir kommen, sie spiegeln sich in mir. Wenn ich mit ihm über dieses Thema spreche, ist er zufrieden. Er wird es nicht bedauern, dass er nicht hier sitzen und meditieren kann. Er kümmert sich nur um die Bauarbeiten und ist völlig zufrieden, wenn ich ihn danach frage.«
[5]Unterweisung (Upadesa)
Bhagavan: »Wenn Mahatmas von ›Ich-Ich‹ reden, meinen sie damit nicht ihren Körper. ›Ich‹ bedeutet das individuelle Ich-Gefühl. Das, was von diesem individuellen Ich-Gefühl befreit ist, ist Atman, das Selbst. Wenn dieses Ich sich nach außen richtet, wird es weltlich und wenn es sich nach innen richtet, wird es zu Aham Sphurana und allumfassend.«
Ein Devotee fragte nach der Bedeutung von Bhagavadgita VII,14: »Wahrlich, meine göttliche Illusion, bestehend aus den Gunas, ist schwer zu überwinden. Diejenigen, die sich nur mir zuwenden, überqueren diese Illusion.«
Bhagavan: »Es bedeutet, dass es sehr schwer ist, MEINE wundervolle Illusion (Maya), die aus den drei Gunas besteht, zu überwinden. Doch jene, die in MIR ihre Zuflucht nehmen, werden sie überwinden. Jene, die in MIR ihre Zuflucht nehmen, sind jene, die Selbstergründung üben und ihre Zuflucht in diesem ›Ich‹ nehmen. Sie können die Illusion überwinden.
Ein anderer Vers lautet: ›Es gibt viererlei Arten von Menschen, die mich verehren, oh Arjuna: jene, die nach weltlichen Objekten suchen, die Leidenden, jene, die nach Wissen streben und der Mann der Weisheit.‹ Dann heißt es weiter: ›Der Beste ist der Mann der Weisheit, der seine Identität dauerhaft in MIR gefunden hat und MICH ausnahmslos verehrt. Denn ich bin dem Weisen unaussprechlich teuer und er ist MIR ebenso teuer.‹ (Bhagavadgita VII,17)
Wie du siehst, ist dem Jnani das ‚Ich’ am liebsten. Er verehrt nur dieses ›Ich‹. Er ist MIR teuer und ich bin ihm teuer. Das bedeutet, dass das Selbst, das immer ›Ich-Ich‹ sagt, teuer ist. Wenn es in der Gita heißt: ›Diene MIR, gib dich MIR hin, Ich bin alles‹, bezieht sich das auf das Selbst und nicht auf eine Göttergestalt. Wenn die Mahatmas von ›Ich‹ reden, meinen sie alleine dieses Selbst und nicht den Körper. Für sie zählt nichts anderes als das Selbst.«
Falsche LehreEinmal behauptete eine Anhängerin, dass Bhagavan sie beauftragt habe, andere in die Mantra-Praxis einzuführen und versammelte eigene Schüler um sich. Das verursachte einigen Aufruhr. Man schenkte ihr kostbare Seidensaris und verehrte sogar ihre Füße, wie man es bei einem Guru tut.
Als ein Devotee vom Ramanashram Schüler der Frau traf, brachte er seine Kritik an. Doch sie hörten nicht auf seinen Protest und behaupteten, dass Bhagavan selbst der Frau diese persönliche Anweisung gegeben habe. Sie hielten sie für die Verkörperung der Heiligen Mutter, die nie lügen würde.
Als der Devotee zum Ashram zurückkam, erzählte er Bhagavan die ganze Geschichte und fragte ihn, ob er ihr jemals eine solche Anweisung gegeben habe. Bhagavan erwiderte: »Was weiß ich? Ich habe so etwas nie zu irgendjemand gesagt.« »Soll ich hingehen und all den Leuten sagen, dass sie sofort damit aufhören sollen?«, fragte der Devotee. Bhagavan meinte lächelnd: »Was für ein Gedanke! Nimm einmal an du gehst hin und sagst ihnen, dass Bhagavan niemals solche Anweisungen gegeben hat. Sie werden dann behaupten, er habe es auf subtile Weise getan oder er sei ihr im Traum erschienen und werden endlos argumentieren. Selbst wenn sie herkommt und zu mir sagt: ›Swami, bist du mir nicht an diesem oder jenem Tag im Traum erschienen und hast mir diese Anweisung gegeben?‹ oder: ›Hast du mir nicht diese Anweisung auf subtile Art gegeben?‹, was kann man dann tun? Wenn ich ›nein‹ sage, muss ich es beweisen. Wer kann sich mit ihnen anlegen?«
Da gab der Devotee sein Vorhaben auf.
Kunju Swami
Als Bhagavan vom Skandashram zum jetzigen Ort am Fuße des Berges umzog, verwaltete Dandapani Swami den Ashram. Er war auch für die Küche verantwortlich. Bhagavan arbeitete unter ihm als Küchenhelfer. Er mahlte die Zutaten fürs Chutney, und wenn Reis und Dhal über Nacht gewässert wurden, zermahlte er sie am nächsten Morgen für die Idllies. Bhagavan tat all diese Arbeiten.
Einmal bekam Bhagavan beim Mahlen Blasen auf seinen Händen. Als Kunju Swami das bemerkte, bat er Bhagavan, mit dem Mahlen aufzuhören. Doch Bhagavan hörte nicht auf ihn. Dandapani hatte einen Korb mit Tamarindenblättern erhalten, briet sie mit Chillies und gab das Ganze Bhagavan, damit er es fürs Chutney zermahlte. Bhagavan mahlte trotz der Blasen.
Kunju Swami konnte sich nicht beherrschen und sagte zu Bhagavan: »Wenn du weitermahlst, werde ich nichts von dem Chutney essen.« Ohne auf den Protest zu reagieren, mahlte Bhagavan weiter und machte das Chutney fertig. Als es zur Essenszeit serviert wurde, weigerte sich Kunju Swami, davon zu essen. Bhagavan bemerkte es und fragte von da an Kunju Swami immer, ob er dies oder das tun dürfe. »Darf ich mit dieser Person sprechen? Darf ich hinausgehen, um mich zu erleichtern? Darf ich essen?« usf. Auf diese Weise neckte er Kunju Swami, indem er für alles um seine Erlaubnis bat.
Als seine Helfer ihn fragten: »Bhagavan, was bedeutet das?«, antwortete er: »Ich muss nach seinen Anweisungen handeln, sonst weigert er sich zu essen. Wenn er sagt, ich soll aufstehen, muss ich aufstehen. Wenn er sagt, ich soll mich hinsetzten, muss ich mich hinsetzten. Ich muss alles tun, was er sagt. Er hat sich geweigert, von dem Chutney zu essen, weil ich nicht mit Mahlen aufgehört habe, wie er es wollte. So ist es mit diesen Leuten. Sie kommen als Sadhakas und versuchen dann uns herumzukommandieren. Alles ist gut, solange wir ihre Anweisungen befolgen.«
Als Kunju Swami das hörte, war er sehr niedergeschlagen und wollte für einige Zeit auf Pilgerreise gehen. Er bat Bhagavan um seine Zustimmung, nach Tirupati gehen zu dürfen. Bhagavan sagte weder ja noch nein, sondern gab ihm verschiedene Arbeiten zu tun, die ihn voll beschäftigten und davon abhielten, nochmals um Erlaubnis zu bitten.
Eines Tages bat er Kunju Swami, ihn auf dem Giri-Pradakshina (Umrundung des Berges) zu begleiten. Kunju Swami hoffte, er würde danach Bhagavans Zustimmung erhalten, packte seine Kleider zusammen und nahm sie mit. Er wollte anschließend direkt zum Bahnhof. Bhagavan beobachtete das und ging absichtlich viel langsamer als gewöhnlich.
Als sie am Ende des Pradakshina durch die Stadt kamen, war der Zug gerade abgefahren. Bhagavan sah Kunju mit einem Lächeln an und sagte: »Kunju, da ist der Zug, mit dem du fahren wolltest. Beeil dich! Versuch ihn zu erreichen!« Alle anderen Devotees lachten. Doch Bhagavan erklärte: »Als er ein kleiner Junge war, brachte ihn jemand – vielleicht sein Guru – zu mir und hat ihn meiner Sorge anvertraut. Jetzt will er von mir fort. Wohin will er gehen? Wenn sein Guru kommt und mich fragt: ‚Wo ist mein Schüler?’, was kann ich ihm dann antworten?«
Daraufhin gab Kunju Swami jeden Gedanken an eine Pilgerreise auf.
Die Devotees sagten zu Bhagavan: »Kunju ist sehr traurig. Er wollte nach Tirupati, um Geistesfrieden zu finden. Wie kann er hier bleiben, wenn Bhagavan ihm nicht verzeiht?« Bhagavan lachte und erwiderte: »Wie seltsam! Ich habe das nicht ernst gemeint. Was hat er denn falsch gemacht? Er konnte den Anblick der Blasen an meinen Händen nicht ertragen, die durch das Mahlen noch schlimmer wurden. Nichts daran ist falsch. Sagt ihm, er soll die dumme Idee mit der Pilgerreise aufgeben. Was kann ich seinem Guru sagen, wenn er auftaucht und nach seinem Schüler fragt?«
Von da an verhielt sich Bhagavan ihm gegenüber wieder völlig normal.
Als Kunju Swami mir diese Geschichte erzählt hatte, meinte er: »Amma, nach diesem Vorfall habe ich einige Pilgerstätten besucht, aber ich konnte keinen Geistesfrieden finden, bis ich wieder zurück war. Das ist Bhagavans Gnade.«
Buchausleihe
Als ich noch nicht lange im Ashram war, hatte ich mir mit Genehmigung Bhagavans das ›Arunachala Mahatmyam‹ in Telugu aus der Bibliothek entliehen. Als ich es ausgelesen hatte, band ich es frisch ein und schrieb in Schönschrift ›Arunachala Mahatyam‹ darauf. Dann gab ich es Bhagavan zurück. Er drehte es nach allen Seiten um und war offensichtlich amüsiert. Ich wusste nicht warum.
Als Rajagopala Iyer hereinkam, sagte Bhagavan: »Sieh mal, Nagamma hat das Buch zurückgebracht, das sie sich ausgeliehen hat. Normalerweise verwenden Frauen die ausgeliehenen Bücher, um damit Töpfe mit Lebensmitteln abzudecken. Die Bucheinbände werden schmutzig und man kann darauf die Ränder der Töpfe sehen. Nicht so bei Nagamma. Sie hat es neu eingebunden und es in besserem Zustand zurückgebracht, als sie es entliehen hat. Sie hat sogar den Buchtitel darauf geschrieben. Sieh her.«
Da Rajagopala Iyer kein Telugu verstand, fragte er, was genau darauf geschrieben stand. »›Arunachala Mahatyam‹. Sie ist eine Dichterin. Sie gibt dem Buch einen völlig neuen Titel. ›Mahatyam‹!« Er lachte.
Ich konnte nicht verstehen, was daran falsch sein sollte und fragte ihn. Da lachte er wiederum und sagte: »›Mahatmyam‹, nicht ›Mahatyam‹. Sieh, was du geschrieben hast.« Er zeigte es mir und korrigierte den Fehler selbst. Ich dachte bei mir: »Oh Herr, wie viele Fehler machen wir in unserem Leben! Deine Gnade komme uns immer wieder zu Hilfe und rette uns!«
Keine Verehrung1943 kam ein Brief von den Devotees in Nellore. Sie wollten zu Bhagavans Geburtstag eine Puja vor seinem Bild feiern und baten um die dafür passenden Mantren. Bhagavan gab den Brief an Jagadeeswara Sastri weiter. Sastri war glücklich, es zu übernehmen.
Als er die Puja-Mantren und ein Gedicht der 1000 Namen Ramanas geschrieben hatte, kam er zu Bhagavan und erbat seine Genehmigung, die erste Puja vor ihm persönlich in der Halle vorzunehmen. Bhagavan sagte lächelnd: »Ach, das also ist dein Wunsch! Ich soll hier sitzen und du vollziehst die Puja vor mir?« »Nein, Bhagavan, nicht vor dir, sondern vor deinen Lotusfüßen«, erwiderte Sastri. Da zog Bhagavan schnell seine Füße zurück und sagte: »Genug mit diesem Unsinn! Geh heim und feire deine Puja vor einem Bild. Verehrung der Füße und des Kopfes des Gurus – wozu das alles?« Sastri konnte nichts darauf erwidern und machte es so, wie Bhagavan es vorgeschlagen hatte.
Wir spürten, dass es eine gute Lektion für alle so genannten heiligen Männer war, die sich von ihren Schülern verehren lassen und dabei vergessen, dass sie ebenfalls sterblich sind.
Ärger und Groll
1944 oder 1945 kam eine Devotee aus Andhra Pradesh zum Ashram und blieb einige Zeit. Sie hatte eine besondere Art der Verehrung. Sie betrachtete Bhagavan als den Herrn Krishna und sich selbst als eine der Hirtinnen. Sie hielt sich damit nicht zurück und schrieb Bhagavan sogar entsprechende Briefe. Bhagavan kümmerte sich nicht darum, gab mir aber ihre Briefe zu lesen. Ich konnte mich nicht beherrschen und tadelte die Frau. Da brauste sie auf und schrieb alle möglichen hässlichen Dinge über mich. Bhagavan meinte lachend: »Lies, was sie geschrieben hat. Alles ist nur über dich.« Ich ärgerte mich sehr und bat Bhagavan, mir ihre Briefe nicht mehr zu geben.
Einige Tage später zerriss die Frau ihre Kleider und lief schreiend auf der Straße herum. Als Bhagavan davon erfuhr, meinte er: »Jemand muss sich ihrer annehmen.« Ich sprach mit einigen Devotees aus Andhra Pradesh. Wir schickten ihrem Mann ein Telegramm und engagierten jemand, der sich bis zu seiner Ankunft um sie kümmerte. Nach einigen Tagen kam ihr Mann und nahm sie mit.
Wenig später erhielten vier oder fünf von uns einen Brief, dass sie uns wegen Verleumdung anklagen würde, weil wir sie als Verrückte abgestempelt hätten. Dann kam sie mit ihrem Anwalt zum Ashram. Bhagavan erklärte ihm alles. Da entschuldigte er sich bei uns, machte ihr Vorwürfe und ging. Als sie spürte, dass sie nichts mehr erreichen konnte, ging auch sie nach Andhra Pradesh zurück.
Im November 1949 erhielt ich einen Brief von ihr. Sie schrieb: »Ich habe davon gehört, dass Bhagavan krank ist. Bitte lass mich wissen, wie es ihm geht. Ich habe früher verleumderische Briefe an dich geschrieben. Es tut mir leid. Du bist wirklich Bhagavans Kind. Bitte verzeih mir und schreibe mir bald.«
Ich erzählte Bhagavan von dem Brief. Er sagte lediglich: »Tatsächlich?« Er sprach drei Tage lang nicht mit mir. Wenn ich mich vor ihm verneigte, schenkte er mir keinen gütigen Blick wie sonst, sondern wandte sich ab. Es kam mir in den Sinn, dass der Grund dafür vielleicht in der Unreinheit meiner Gesinnung lag, da ich immer noch einen Groll gegen die Frau hegte und ihr nicht geantwortet hatte. Ich kaufte sofort eine Postkarte und schrieb ihr.
Anschließend ging ich zu Bhagavan. Ich erzählte ihm, dass ich der Frau soeben geantwortet hatte und er sagte zufrieden: »Ja, ja.« Dann rief er einige Helfer herbei und sagte: »Diese telugische Frau hat sich für ihre Verleumdung entschuldigt und nach meiner Gesundheit gefragt. Nagamma hat ihr geantwortet.« Er wandte sich mir zu und sah mich gütig an. Ich war sehr glücklich und zufrieden. So ist es, wenn man zu Füßen des Gurus lebt – alle Unreinheiten des Geistes werden beseitigt.
Postmeister Rajayya
Jene, die in der Küche arbeiteten, servierten Bhagavan gerne etwas mehr als den anderen. Er bemerkt diese ungleiche Behandlung und versucht, sie davon abzubringen. Der Postmeister Rajayya machte es ebenso. Bhagavan sah ihn missbilligend an, sagte aber nichts, und so machte Rajayya es immer wieder.
Eines Abends wurde Milchpudding zubereitet. Chinna-swami fand, er sei besonders gut und stachelte Rajayya an, Bhagavan davon etwas mehr als üblich zu servieren. Da rief Bhagavan empört: »Da, wieder derselbe Unsinn, dieselben Tricks! Warum schöpfst du mir mehr als den anderen? Wenn Bhagavan bedient wird, ist der Schöpfer immer übervoll, während er nur halbvoll ist, wenn die anderen bedient werden. Wie oft habe ich euch gesagt, das bleiben zu lassen! Keiner hört mir zu. Derjenige, der den Schöpfer in der Hand hält, denkt, er habe die Macht eines Steuereintreibers und könne alles tun. Er ist derjenige, der bedient und wir sind diejenigen, die essen, was er uns auftischt.«
Prasadam aus Bhagavans Händen
Einmal kam ich am späten Nachmittag in den Ashram. Die Devotees aßen Kokosnüsse und auch Bhagavan aß. Als er mich kommen sah, sagte er: »Da ist Nagamma. Gebt ihr auch etwas davon.« Doch es war nichts mehr übrig.
Wenn jemand am Nachmittag etwas zu essen brachte und nichts mehr übrig war, wenn ich kam, bot Bhagavan mir stets etwas von dem an, was er gerade in der Hand hatte. Aber da es gewöhnlich nur sehr wenig war, lehnte ich immer ab und ging in die Küche, um mir dort etwas zu holen. Ich wollte es auch diesmal so halten. Bhagavan rief mich herbei und sagte: »Du bekommst in der Küche nichts mehr davon. Komm her! Es schmeckt sehr gut.« Da gab er mir alles, was er in der Hand hatte. Als ich dagegen protestieren wollte, sagte er: »Das macht nichts. Ich habe bereits genug gegessen. Dein Anteil ist nur der Rest.« Da nahm ich es als ein besonderes Prasadam entgegen. Meine Freude war unbeschreiblich.
Als Bhagavan noch auf dem Berg lebte und in der Anfangszeit des Ashrams arbeitete er in der Küche mit. Devotees erhielten Prasadam aus seinen Händen. Aber seit ich hier war, ist so etwas nicht mehr geschehen. Deshalb dachten alle, es sei ein besonderer Gunsterweis.
Sannyasa für Frauen
1946 oder 1947 kam das Oberhaupt des Kamakoti Peetam
[6] zum Arunachala und wohnte in der Pilgerherberge der Stadt. Es wurden öffentliche Lesungen im Arunachala-Tempel und an anderen Orten vorbereitet.
Eines Tages kam der bekannte Sanskrit-Gelehrte Kalluri Veerabhada Sastri zu Bhagavan. Ich kannte ihn gut, da er in Madras Vorträge über die Bhagavadgita gehalten hatte. Er fragte mich, ob ich den Darshan von Kamakoti Swami gehabt habe. Da ich kein Interesse daran hatte, meinte ich ausweichend: »So viel ich weiß trifft der Swami keine Brahmanen-Witwen, die ihre Haare nicht abgeschnitten haben.« Er meinte: »Ja, aber du könntest ihn bei einem öffentlichen Treffen von weitem sehen.« Ich erwiderte: »Es ist fürs Sadhana hilfreich, wenn man mit einem Gelehrten sprechen kann, aber was hat man davon, ihn nur aus der Ferne zu sehen?« Er stimmte mir zu.
Eines Morgens war der Swami zum Giri-Pradakshina aufgebrochen und würde auch beim Ashram vorbeikommen. Die Devotees spekulierten darüber, ob er hereinkommen würde oder nicht. Ich wollte mich nicht daran beteiligen und setzte mich zu Bhagavan in die Halle.
Um 9 Uhr hieß es, dass der Swami auf dem Weg zum Ashram sei. Alle gingen hinaus und warteten am Ashramtor auf ihn, nur Bhagavan und ich nicht. Bhagavan fragte mich, warum ich mich ihnen nicht angeschlossen hätte. Ich antwortete, dass der Swami keine Brahmanenwitwen mit Haaren auf dem Kopf sehen würde und ich wollte ihn und die anderen in keine peinliche Lage bringen. Bhagavan nickte und sah mich mitleidsvoll an.
Wenig später kam der Swami mit seinem Gefolge, blieb beim Ashramtor stehen, sah sich um und ging weiter. Die Ashrambewohner kamen zurück und berichteten davon.
Bei einem öffentlichen Vortrag am Abend sprach der Swami ausführlich über die Oberhäupter von religiösen Vereinigungen. Jeder müsse sich an die entsprechende Tradition halten, während ein Avadhuta diesen Beschränkungen nicht unterworfen sei. Doch es sei sehr schwer, diesen Zustand zu erlangen und nur für so eine große Seele wie Ramana Maharshi möglich.
Raju Sastri und andere Gelehrte kamen täglich aus der Stadt, um das Veda-Parayana und die Puja im Tempel der Mutter auszuführen. Einige Tage später kamen sie etwas früher als sonst und erzählten Bhagavan, dass der Swami ihnen verboten habe, die Puja im Tempel der Mutter zu feiern, da für Frauen kein Sannyasa erlaubt sei und die Errichtung eines Lingam über der Ruhestätte der Mutter den heiligen Schriften widerspräche. Es sollte deshalb in diesem Tempel keine Puja stattfinden.
Bhagavan erwiderte: »Ich habe in der Ramana Gita auf diese Frage eine Antwort gegeben. Es gibt für Frauen kein Verbot für Sannyasa und Samadhi. Was können wir sonst noch sagen?« Sie fragten ihn, welche Antwort sie dem Swami überbringen sollten. Bhagavan erwiderte: »Warum kümmert ihr euch um solche Auseinandersetzungen? Solange er das Oberhaupt dieses Peetam ist, muss er die Regeln dieses Peetam befolgen. Also hat er sein Verbot ausgesprochen, wie es in solchen Fällen üblich ist. Es ist besser, wir tun schweigend unsere Arbeit. Wer von euch kommen will, kann kommen. Die anderen können wegleiben. Warum soll man alle Arten von Zweifel hegen?«
Die Worte Bhagavans überzeugte sie.
In der Ramana Gita XIII,9 heißt es: »Was Mukti und Jnana betrifft, gibt es keinen Unterschied zwischen Mann und Frau. Der Körper einer Frau, die während ihres Lebens befreit worden ist, soll nicht verbrannt werden, denn er ist ein Tempel.«
[1] die vier großen Tamil-Heiligen aus dem 7./8. Jh.
[2] gemeint ist OM
[3] Einschub der Übers.; aus Sadhu Arunachala, S. 120f. Das ›Na Karmana‹ [wörtl.: nicht durch Handlung] stammt ursprünglich aus der Maha Narayana Upanishad. Es wird als letzter Hymnus des Veda-Parayana gesungen. Im Ramanashram war es Brauch, dass die Devotees sich dazu erhoben und sich zum Schluss vor Ramana verneigten. 1938 hat Ramana es ins Tamil übersetzt.
[4] Die Monatsblutung gilt als Verunreinigung. Frauen sollten während dieser Zeit nicht zum Ashram kommen, nicht meditieren und sich nicht mit geistigen Dingen befassen.
[5] Annamalai Swami zog sich später nach Palakothu zurück und führte ein meditatives Leben.
[6] Oberhaupt des Klosters in der Nachfolge von Adi Shankara